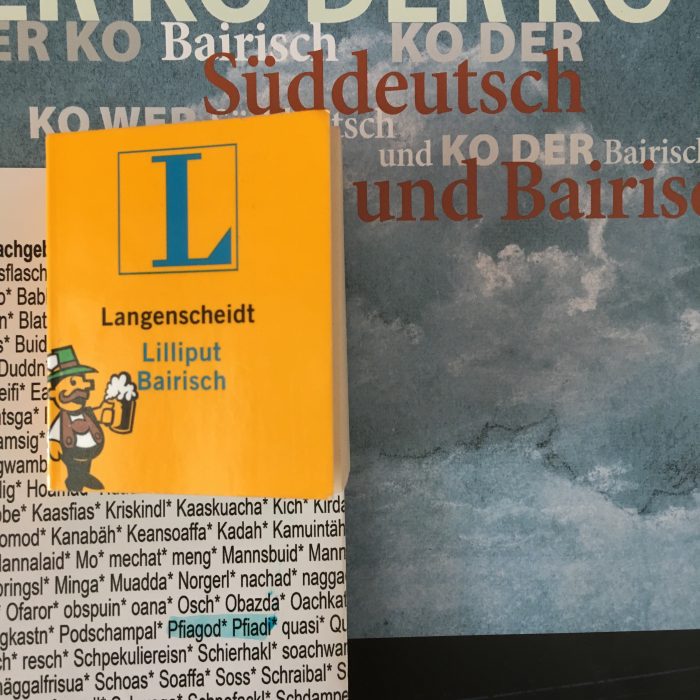Ein extra großes Dankeschön werden sicherlich die Truthähne sagen, die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika am Vorabend von Thanksgiving begnadigt werden, also nicht in der Küche des Weißen Hauses landen. Das Verspeisen dieses Geflügels ist nämlich fester Bestandteil der Feierlichkeiten am vierten Donnerstag des Novembers.
Dieser amerikanische Feiertag steht ganz im Zeichen der Dankbarkeit gegenüber der Familie, den Freunden, den Bekannten und Arbeitskollegen. Der Dank gilt aber auch, ähnlich wie beim europäischen Erntedankfest der Natur und der Umwelt, die einen mit vielen Gaben beschenkt. Diese werden dann gerne in reicher Menge aufgetischt und verspeist. Zum Truthahn werden Kartoffelpüree, Kürbiskuchen, Gemüse und Cranberry-Sauce gereicht. Auf einer Webseite las ich, dass Amerikaner pro Kopf an diesem Tag bis zu 4.500 Kalorien zu sich nehmen! Die könne man ja, so der Autor der Informationsseite über das Fest augenzwinkernd, am nächsten Tag beim Durchlaufen der Geschäfte auf der Jagd nach Sonderangeboten wieder abtrainieren: schließlich sei am Freitag nach Thanksgiving „Black Friday“.
Aber zurück zu Thanksgiving, dessen Ursprung wahrscheinlich mit der Besiedelung des amerikanischen Kontinents zusammenhängt. Laut einer Quelle hätten die Pilgerväter 1621 gemeinsam mit dem Stamm der Wampanoag Erntedank gefeiert, um sich für deren Hilfe nach ihrer Ankunft in Amerika zu bedanken. Eine andere Quelle besagt, dass sich spanische Kolonialisten für erhaltene Lebensmittel mit einem Fest beim Volk der Caddo bedankt hätten. Diese kolonialen Wurzeln sind heute teils vergessen, teils in den Hintergrund gerückt. Heute wird das Fest unabhängig von Herkunft und Konfession gefeiert – ein Brauch, der zusammenführt und nicht ausgrenzt.
In unserer bairischen Familie wurde der Brauch durch unsere amerikanische Schwiegertochter eingeführt. Bei uns muss es auch nicht immer einen ganzen Truthahn geben, was die beiden von Joe Biden begnadigten Tiere sicherlich gut finden. Wichtig ist das gemeinsame Essen und Zusammensein und die Dankbarkeit dafür: Thanks to Sophie for Thanksgiving!
Foto: Birgitta Unger-Richter, Werbung für Geflügel in der Burgund, Frankreich.
Dieser Beitrag ist Sophie gewidmet: durch sie haben wir neue Bräuche kennengelernt, die unser Leben bereichern.