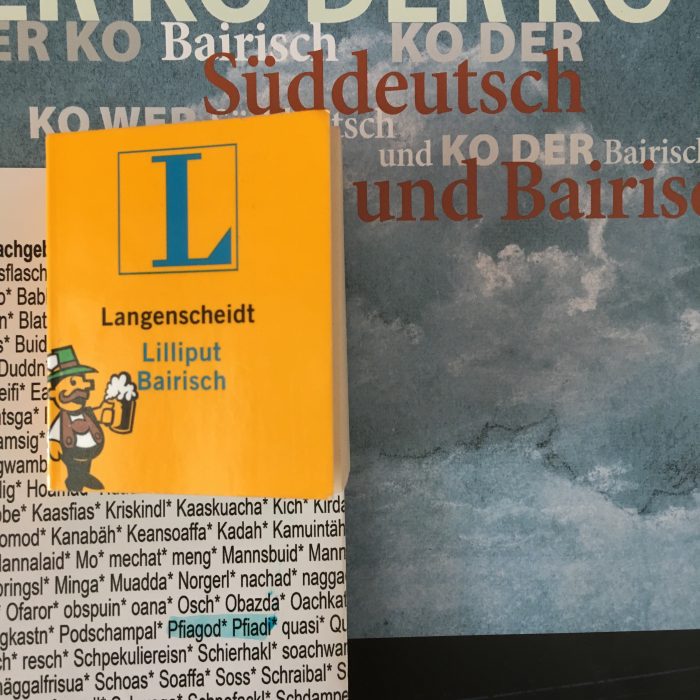Nach einem Urlaub voller Pasta, Zucchini, Auberginen, Mozzarella, Weißbrot und Gelato machte ich eine Kaffeepause in Bayern, wo ich in der Kühltheke Brezen mit Leberkäse entdeckte. Eine fand schnell den Weg auf meinen Teller und dann in meinen Magen. Der Leberkäse war dünn aufgeschnitten und mit Gurken und Salat belegt. Etwas ungewöhnlich, aber gut. Ansonsten wird der Leberkäse ja eher in dicken Scheiben, gerne in einer Semmel serviert. So hat er auch Karriere als Fotomodell gemacht, wie mir mein geschätzter Kollege Erik erst neulich verriet. Ich durfte den Leberkäse in unterschiedlichsten Aufnahmen in seinem Kalender bestaunen. Der Bayerischer Rundfunk hatte dem (angeblich) ersten Leberkäskalender 2022 einen Beitrag gewidmet und den Herausgeber des Jahresbegleiters zitiert: „Nackte Frauen sind out! Leberkas ist in!“
Was hätte wohl der Erfinder der Brühwurst vor 200 Jahren dazu gesagt? Es war laut einer vertrauenswürdigen Quelle ein Pfälzer, Hofmetzger von Kurfürst Karl Theodor, der als Erster feingehacktes Schweine- und Rindfleisch in einer Brotform backte. Zu den Grundzutaten kamen später dann Schweinespeck und Gewürze dazu. Der namensgebende Anteil an Leber soll heute übrigens laut einer deutschen Verordnung mindestens 5% betragen. Ist dies nicht der Fall, so wird er als „Fleischkäse“ oder „Bayrischer Leberkäse“ bezeichnet. Käse ist nur im „Pizzaleberkäse“ zu finden.
Pizza esse ich allerdings lieber mit knusprigem Teigboden und im Holzofen gebacken – sie schmeckt nach Urlaub, Leberkäse pur nach Heimat. Darin sind sich mein Kollege und ich einig. Für eine Leberkassemmel läßt er sogar (fast) jedes andere Gericht stehen – Leberkäse ist auch bei ihm „in“….
Die Herkunft der Bezeichnung „Leberkäse“ ist laut Online-Lexikon Wikipedia nicht ganz geklärt: “ Der Begriff setzt sich zusammen aus den Substantiven Leber und Käse. Im bairischen wird eine essbare Masse als „Kas“ bezeichnet. „Leber“ leitet sich aus „Laib“ ab, was auf die Form des Fleischkäses zurückzuführen ist. In einer anderen Erklärung erinnert die Form des Produktes an einen Laib Käse.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Fleischk%C3%A4se abgerufen am 27. Juli 2023).
Foto: Birgitta Unger-Richter, Die oben genannte Leberkäsbreze vor dem Verzehr.